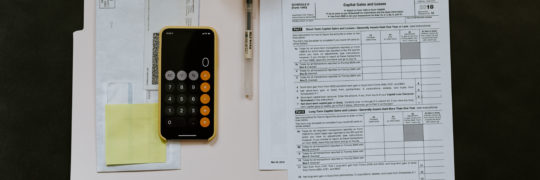Vorbemerkung: Wir können und dürfen an dieser Stelle und allgemein keine steuerberatende Funktion ausüben. Wir können euch aber sehr gerne bei Bedarf an erfahrene Steuerberater*innen mit Kenntnissen im Bereich Gemeinnützigkeit im Vereinswesen weiterleiten. Eine vertiefende Hilfe bietet auch die Broschüre „Vereine und Steuern“ der Finanzverwaltung NRW. Achtet jedoch auf das Veröffentlichungsdatum – eventuell sind hier nicht alle aktuellen steuerlichen Änderungen berücksichtigt.
Ist meine Ortsgruppe ein Verein?
Jede Ortsgruppe der KLJB ist mit ihrer Gründung ein Verein. Man unterscheidet jedoch nicht eingetragene bzw. nicht rechtsfähige Vereine von eingetragenen Vereinen (häufig kurz e.V.). Ohne eine offizielle Eintragung im Vereinsregister wird eine KLJB Ortsgruppe daher als nicht eingetragener Verein geführt, für den aber die meisten Grundsätze des Vereinsrechts gelten.
Was unterscheidet nicht eingetragene Vereine von einem e.V.?
Der größte Unterschied dieser beiden Vereinstypen liegt für KLJB Ortsgruppen in der Haftung von Vorstand und Mitgliedern. Eingetragene Vereine sind eigenständige juristische Personen und können als solche auch für Rechtsgeschäfte und Vermögen haften. Bei nicht eingetragenen Vereinen tragen alle Mitglieder oder der Vorstand die Risiken und Gefahren ihrer Entscheidungen gemeinschaftlich. Wenn also z. B. Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden oder der nicht eingetragene Verein Schulden macht, müssen die Mitglieder dafür mit ihrem Privatvermögen aufkommen. Dabei ist das Risiko insbesondere bei den Ortsgruppen recht hoch, die jährlich mit hohen Summen hantieren, weil sie Zeltlager, Scheunenpartys oder große Osterfeuer ausrichten.
Gleichzeitig führt eine Vereinseintragung beim Amtsgericht auch dazu, dass Änderungen von Satzung und Vorstand über eine*n Notar*in im Vereinsregister eingetragen werden müssen. Ihr habt also bei jeder Vorstandsänderung einen finanziellen und organisatorischen Mehraufwand.
Gemeinnützigkeit
Was bedeutet überhaupt „gemeinnützig“?
In erster Linie ist die Gemeinnützigkeit eine Form der Steuerbegünstigung. Diese gewährt der Staat vor allem Organisationen und Vereinen, die Aufgaben übernehmen, die im Interesse der Allgemeinheit sind und die ansonsten der Staat selbst umsetzen müsste. Eine Liste der möglichen gemeinnützigen Ziele findet sich in den Paragrafen 52-54 der Abgabenordnung.
Konkret für die KLJB bedeutet das, dass wir als Verband dem Staat einen Teil der Jugendarbeit im ländlichen Raum abnehmen und dafür als Verein eine bevorzugte Behandlung erhalten
Wie sieht diese bevorzugte Behandlung aus? Welche Vorteile hat es, gemeinnützig zu sein?
Die drei Hauptvorteile für gemeinnützige Vereine sind:
- Der Verein ist in gewissen Grenzen für gemeinnützige Tätigkeiten von der Körperschaftssteuer, der Gewerbesteuer, der Umsatzsteuer und der Grundsteuer befreit.
- Der Verein kann Personen für ihre ehrenamtliche Tätigkeit steuerfreie Aufwandsentschädigungen zukommen lassen (die sogenannte „Ehrenamtspauschale“).
- Der Verein kann für Spenden und Mitgliedsbeiträge Zuwendungsbestätigungen (auch Spendenbescheinigungen) ausstellen, die es z. B. Spender*innen erlaubt, durch ihre Spende Steuern zu sparen.
Weiterhin ist die Gemeinnützigkeit in vielen Fällen Voraussetzung, damit ein Verein öffentliche Mittel aus Fördertöpfen beantragen kann, und es gibt häufig Vergünstigungen bei Banken und vielen anderen Dienstleistungen.
Wie wird man gemeinnützig?
An dieser Stelle ist es wichtig, zwischen der Anerkennung der Gemeinnützigkeit und gemeinwohlorientiertem (ugs. gemeinnützigem) Handeln zu unterscheiden. Als Träger der freien Jugendhilfe (siehe unten) muss eine KLJB Ortsgruppe gemeinwohlorientiert handeln und alle Kriterien für eine Anerkennung der Gemeinnützigkeit erfüllen. ABER: Ein Verein ist erst gemeinnützig anerkannt, wenn das Finanzamt ihm das durch einen Freistellungsbescheid bescheinigt. Letzteres bedarf eines Antrags an das Finanzamt. KLJB Ortsgruppen handeln daher zwar gemeinnützig, sind aber nicht zwangsläufig ein anerkannter gemeinnütziger Verein und dürfen daher ohne Freistellungsbescheid keine Zuwendungsbestätigungen ausstellen, die die*der Spender*in steuerlich geltend machen kann.
Um auch offiziell als gemeinnützig anerkannt zu werden und die oben genannten Vorteile in Anspruch nehmen zu können, muss also ein formloser Antrag an das zuständige Finanzamt geschickt werden. Diesem Antrag ist die Satzung der Ortsgruppe mit Beschlussvermerk und Unterschriften beizufügen, die bei Gestaltung nach unserer Mustersatzung den Anforderungen des Finanzamts entsprechen sollte. Außerdem benötigt das Finanzamt unterschriebene Protokolle der letzten Mitgliederversammlungen, um die Wahlen des aktuellen Vorstands nachvollziehen zu können. Zunächst erhaltet ihr dann einen Feststellungsbescheid auf Basis eurer Satzung und nach der ersten eingereichten Körperschaftsteuererklärung einen Freistellungsbescheid.
Welche Voraussetzungen müssen wir erfüllen, um einen Freistellungsbescheid zu erhalten?
Neben dem Verfolgen von mindestens einem der mildtägigen, kirchlichen oder gemeinnützigen Zwecke aus §§ 52-54 der Abgabenordnung gibt es einige weitere wichtige Voraussetzungen für die Erteilung eines Freistellungsbescheides. Diese prüft das Finanzamt alle drei Jahre durch Vorlage eurer Finanzunterlagen.
- Selbstlosigkeit: Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden.
- Zeitnahe Mittelverwendung: Der Verein muss seine vereinnahmten Mittel grundsätzlich laufend (zeitnah) für die satzungsgemäßen Zwecke verausgaben (es gibt Ausnahmen).
- Die Bildung von Rücklagen ist nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen zulässig. Ihr müsst also aufpassen, wieviel Geld ihr jährlich auf die hohe Kante legt.
- Ausschließlichkeit: Die wirtschaftliche Betätigung darf nicht zum Selbstzweck werden und daher auch nicht als Vereinszweck in die Satzung aufgenommen werden. Unter die wirtschaftliche Betätigung fallen insbesondere Getränke- und Speisenverkäufe.
- Unmittelbarkeit: Der Verein muss seine steuerbegünstigten Ziele grundsätzlich unmittelbar selbst verwirklichen, d.h. ihr dürft eure Mittel nur in wenigen Ausnahmen an andere Vereine und Organisationen weitergeben.
Welcher Aufwand ist mit der Gemeinnützigkeit verbunden?
Neben der einmaligen Beantragung des Freistellungsbescheides muss die Ortsgruppe alle drei Jahre dem Finanzamt nachweisen, dass sie auch wirklich gemeinnützig gewirtschaftet hat. Dazu braucht das Finanzamt die Protokolle der Mitgliederversammlungen und jeweils einen Jahresbericht. Außerdem müsst ihr eine Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) einreichen. Dies ist eine recht einfache Übersicht über Einnahmen und Ausgaben, die ihr als Verein sowieso zum Jahresabschluss erstellen solltet. Der Aufwand hält sich also durchaus in Grenzen. Für die Aufstellung einer korrekten Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) müsst ihr allerdings die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung beachten. Alle Daten werden dann im Rahmen einer Körperschaftsteuererklärung über ELSTER an das Finanzamt übermittelt.
Können nur eingetragene Vereine einen Freistellungsbescheid beantragen?
Nein. Die Anerkennung der Gemeinnützigkeit hat erstmal nichts mit der Eintragung im Vereinsregister zu tun. Auch als nicht eingetragener Verein könnt ihr beim Finanzamt einen Freistellungsbescheid beantragen. Es bietet sich sogar an, erst den Freistellungsbescheid zu beantragen, da die Eintragung im Vereinsregister dann gebührenbefreit durchgeführt wird.
Sind all unsere Tätigkeiten steuerbefreit? Auf welche Grenzwerte müssen wir aufpassen?
Für die steuerliche Betrachtung sollte eure Buchhaltung folgende Bereiche unterscheiden und die Einnahmen und Ausgaben danach auftrennen:
- Der steuerfreie ideelle Vereinsbereich: z.B. Mitgliedsbeiträge, KJP-Zuschüsse, Spenden
- Die steuerfreie Vermögensverwaltung: z. B. Zinsen und Ausschüttungen
- Der steuerbegünstigte, wirtschaftliche Zweckbetrieb: z.B. Bildungsveranstaltungen, Gruppenstunden, Zeltlager, Leiterrunden
- Der steuerpflichtige, wirtschaftliche Geschäftsbetrieb: z. B. Scheunenball, Osterfeuer, Getränkeverkäufe
Einen steuerbegünstigten, wirtschaftlichen Zweckbetrieb könnt ihr als Ortsgruppe jedoch nur dann ausweisen, wenn ihr als gemeinnützig anerkannt seid, weil ein Zweckbetrieb dem Erreichen der satzungsgemäßen, gemeinnützigen Zwecke dient. Ansonsten wird der Zweckbetrieb dem steuerpflichtigen, wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zugeordnet. Daher ist bei einem Gewinn von über 5.000 € jährlich Körperschafts- und Gewerbesteuer zu zahlen, wobei die Einnahmen des ideellen Bereichs bei der Gewinnermittlung nicht berücksichtigt werden.
Ein als gemeinnützig anerkannter Verein unterliegt nur dann der Körperschafts- und Gewerbesteuer, wenn die Bruttoeinnahmen aus dem steuerpflichtigen, wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb insgesamt jährlich die Summe von 45.000 € übersteigen. Hier werden also wirklich nur die wirtschaftlichen Tätigkeiten (z. B. Osterparty) berücksichtigt.
Für die Umsatzsteuer gelten jedoch andere Grenzen. Ein Verein kann wie jedes Unternehmen grundsätzlich die sogenannte Kleinunternehmer*innenregelung in Anspruch nehmen. Liegt der Gesamtumsatz aus der unternehmerischen Betätigung (also der wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe) des Vorjahres unter 25.000 Euro und der voraussichtliche Jahresumsatz des laufenden Jahres unter 100.000 Euro kann der Verein als Kleinunternehmer auf die Umsatzbesteuerung verzichten. Hier kommt nun auch nochmal die Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe ins Spiel (siehe unten): Leistungen der Jugendhilfe sind nach § 4, Nr. 23 und 25 UstG von der Umsatzsteuer befreit. Dies betrifft im Normalfall einen Großteil der Dinge, die ihr dem Zweckbetrieb zuordnen würdet (Zeltlager, Gruppenstunden, …). Unter Umständen kann es trotzdem sinnvoll sein, eine Umsatzbesteuerung zu wählen, da ihr euch dann die gezahlte Umsatzsteuer bei z. B. Anschaffungen erstatten lassen könnt. Dies ist im Einzelfall pro Ortsgruppe zu prüfen.
An dieser Stelle kann keine steuerberatende Funktion wahrgenommen werden, daher empfehlen wir in grundsätzlichen Fragen immer den Kontakt zum*r Steuerberater*in bzw. dem Finanzamt.
Träger der freien Jugendhilfe
Was ist ein anerkannter Träger der freien Jugendhilfe?
Ähnlich wie bei der Gemeinnützigkeit gewährt der Staat Organisationen und Vereinen, die Jugendhilfe betreiben – also die Entwicklung und Erziehung junger Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern –, einige Vorteile. Zum einen könnt ihr so von den Mitteln des Kinder- und Jugendförderplans profitieren und eure Veranstaltungen, Fortbildungen und Anschaffungen z. B. durch den Kreis oder die Ferienfreizeitunterstützung des BDKJ fördern lassen. Neben den finanziellen Vorteilen habt ihr die Möglichkeit politisch mitzuwirken in Jugendhilfeausschüssen und Arbeitsgemeinschaften und habt einen bevorzugten Status in der Zusammenarbeit mit den örtlichen Jugendämtern.
Was müssen wir tun, um anerkannter Träger der freien Jugendhilfe zu werden?
Das ist ganz einfach: Kinder- und Jugendarbeit. Als Mitglied im Diözesanverband der KLJB im Erzbistum Paderborn seid ihr als Ortsgruppe automatisch anerkannter Träger der freien Jugendhilfe. Wir als Diözesanverband bürgen quasi dafür, dass unsere Ortsgruppen die nötigen Voraussetzungen erfüllen. Daher investieren wir auch viele Ressourcen, um euch bei der Kinder- und Jugendarbeit vor Ort zu unterstützen.
Spenden, Gemeinnützigkeit und Steuern in der Praxis
Unsere Bank möchte neuerdings Kontoführungsgebühren haben. Was können wir tun?
Häufig gewähren Banken anerkannten gemeinnützigen Organisationen Rabatte bei ihren Gebühren oder erlassen diese gleich ganz. In den letzten Jahren gehen immer mehr Banken dazu über, dass sie dafür einen Freistellungsbescheid als Nachweis haben möchten. Den können viele Ortsgruppen jedoch nicht vorlegen, weil sie – wie oben beschrieben – nicht vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt sind. Als Diözesanverband können wir euch eine Bescheinigung ausstellen, dass ihr anerkannter Träger der freien Jugendhilfe seid und damit faktisch alle Voraussetzungen für die Ausstellung eines Freistellungsbescheids erfüllen müsst. Ob eure Bank das allerdings als gleichwertig anerkennt, ist schwer zu sagen. Es gibt durchaus Banken, die hart bleiben und die Kontoführungsgebühren erst bei Vorlage des Freistellungsbescheids erlassen. Einen Versuch ist jedoch wert.
Ein örtliches Unternehmen, ein anderer Verein oder eine Person möchte uns Geld spenden und dafür eine Spendenbescheinigung haben. Was müssen wir beachten?
Eine Spendenbescheinigung, offiziell Zuwendungsbestätigung genannt, können nur Vereine ausstellen, die einen Freistellungsbescheid vom Finanzamt erhalten haben. Wenn ihr einen Freistellungsbescheid habt, ist es wichtig, dass ihr euch sehr genau an die Formvorschriften für eine Zuwendungsbestätigung haltet. Vorlagen des Bundesfinanzministeriums findet ihr hier (https://esth.bundesfinanzministerium.de/esth/2016/C-Anhaenge/Anhang-37/I/anhang-37-I.html).
Bis zu einer Spendensumme von 300 € müsst ihr noch nicht mal eine Zuwendungsbestätigung ausstellen, sondern die*der Spender*in kann einen vereinfachten Nachweis nutzen. Dazu genügt ein Nachweis der Zahlung (z. B. Kontoauszug) und eine Bestätigung, über eure Gemeinnützigkeit. Einen Vordruck für eine solche Bestätigung könnt ihr hier herunterladen.
Wenn ihr als Ortsgruppe keinen Freistellungs-/Feststellungsbescheid besitzt, dürft ihr keine Zuwendungsbestätigungen ausstellen und auch nicht den vereinfachten Nachweis nutzen. Ihr könnt trotzdem Spenden gegen Quittung einnehmen, die kann die*der Spender*in jedoch nicht steuerlich geltend machen.
Bitte beachtet zusätzlich, dass ihr eine Zuwendungsbestätigung nur für die Person/Organisation ausstellen könnt, die euch die Spende zukommen lassen hat. Das gilt insbesondere bei Überweisungen, wo Kontoinhaber*in und Zuwendungsgeber*in identisch sein müssen. Eine Spende im Namen Dritter ist also nicht möglich.
Kann ich die Buchführung einfach per Excel machen?
Für die meisten von euch ist das möglich, weil ihr nur einer Aufzeichnungspflicht unterliegt. Insgesamt solltet ihr aber die folgendes beachten: Die Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) schreiben zwei ganz wichtige Dinge für eure Buchhaltung vor: Erstens muss es zu jeder Buchung auch einen Beleg (Kassenzettel, Rechnung, Reisekostenerstattung) geben. Zweitens dürfen Buchungseinträge, wenn sie einmal eingetragen wurden, nicht verändert werden, ohne dass diese Veränderung protokolliert werden.
Letzteres ist jedoch bei einer einfachen Exceltabelle nicht gegeben. Hier könnt ihr ohne Nachvollziehbarkeit alle Einträge nachträglich ändern. Ihr könnt einen Umweg über ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) gehen, dass alle Änderungen protokolliert, eure Buchhaltung und das Kassenbuch per Hand schriftlich führen oder eine Software nutzen, die GoBD konform arbeitet.
Die GoBD gelten in der Schärfe nur für wenige Ortsgruppen. Für alle anderen ist die Buchführung mit Excel möglich. Wir bieten euch aber auch kostenlos die Nutzung von Campflow, ein Tool zur digitalen Buchführung, an. Alle Infos dazu findet ihr hier: https://www.campflow.de/rahmenvertrag/kljb-paderborn
Wir möchten die Mitgliedsbeiträge per Lastschrift einziehen. Was müssen wir dafür tun?
Zunächst müsst ihr bei der Deutschen Bundesbank eine Gläubiger Identifikationsnummer beantragen: https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/serviceangebot/sepa/glaeubiger-identifikationsnummer
Mit dieser Nummer könnt ihr dann zu eurer Bank gehen und mit eurer*m Berater*in die weiteren Schritte zur Umsetzung der Lastschrifteinzüge besprechen. Dort erhaltet ihr auch die entsprechende Software und alle weiteren Informationen.
Eine Vorlage für ein Lastschriftmandat für Mitgliedsbeiträge könnt ihr auf unserer Homepage hier herunterladen. Dieses müsst ihr dann entsprechend anpassen.
Dürfen Mitglieder Geschenke und Rabatte erhalten?
Das ist möglich, hier müsst ihr jedoch gut aufpassen – ob nun als e.V. oder nicht eingetragener Verein, mit oder ohne Freistellungsbescheid. In euren Satzungen steht, dass Vereinsmitglieder keine Zuwendungen aus dem Verein erhalten dürfen. Insbesondere dürfen Mitglieder keine Geldgeschenke erhalten.
Es gibt jedoch einige Ausnahmen. So ist es z. B. erlaubt, allen Mitgliedern Vergünstigungen oder Geschenke im Wert von insgesamt 40 € jährlich ** zukommen zu lassen, beispielsweise durch kleine Weihnachtsgeschenke, Preisnachlässe bei Ferienfreizeiten und Aktionen sowie kostenlosen Getränke bei „geselligen“ Veranstaltungen, die keine Veranstaltungen der Kinder- und Jugendhilfe darstellen.
Zusätzlich ist es möglich, bei besonderen Anlässen (Jubiläum, Wahl, Geburtstag, etc.) einer bestimmten Person pro Anlass ein Geschenk von 60 € zukommen zu lassen. Hier gilt der Wert von 60 € pro Person pro Anlass und nicht pro Person jährlich wie oben beschrieben.
Aber Achtung: Die jährlichen Aufwendungen für ein Mitglied sollten den gezahlten Jahresbeitrag nicht übersteigen. Wenn ihr also nur 20 € Jahresbeitrag einnehmt, dürft ihr insgesamt für persönliche Anlässe und allgemeine Vergünstigungen auch nur 20 € pro Person aufwenden. Die genannten Beträge von 40 € bzw. 60 € gelten nur, wenn der Jahresbeitrag entsprechend hoch ist.
Ausgenommen von diesen Grenzen sind Veranstaltungen und Dinge, die eurem Satzungszweck direkt dienen. Wenn ihr also allen Teilnehmer*innen einer Gruppenstunde kostenlos Getränke zur Verfügung stellt, wird dies nicht als Zuwendung an Mitglieder gewertet.
Bei größeren Helfer*innenfesten oder anderen Aufmerksamkeiten bietet sich ggf. die Nutzung der Ehrenamtspauschale an, um nicht in Konflikt mit den Freigrenzen für Zuwendungen zu geraten.
Die oben genannten Regelungen gelten prinzipiell auch bei Vermietungen von Räumen und Gegenständen (WC-Wagen, Zelte, usw.). Vergünstigungen und kostenlose Abgaben an Mitglieder werden als Zuwendungen gewertet und dürfen daher die Freigrenzen nicht überschreiten.
** Grundsätzlich wurde die Freigrenze 2019 auf 60 € jährlich angehoben, dies wird aber nicht in allen Bundesländern und von allen Finanzämtern für Vereine übernommen und anerkannt. Fragt vorher bei eurem Finanzamt nach und bleibt im Zweifelsfall lieber darunter.
Wo bekomme ich weitere Informationen?
Grundlegende Informationen zu allen Themen des Vereinsrechts und der Gemeinnützigkeit erhältst du über den Diözesanvorstand und das Diözesanbüro. Wir helfen gerne weiter und vermitteln an erfahrene Expert*innen weiter, um Fachfragen zu klären.
Auch die Mitarbeiter*innen der Finanzämter bieten eine Beratung an. Sie sind insbesondere mit dem Hinweis auf gemeinnützige Vereine sehr hilfsbereit und können bei den Prozessen rund um die Gemeinnützigkeit unterstützen. Schau einfach auf der Homepage eures lokalen Finanzamts nach einer*m Ansprechpartner*in.
Eine gute Quelle zum Einlesen stellt auch die Kanzlei Winheller zur Verfügung. Auf deren Homepage findet ihr viele Informationen und einen Newsletter, der immer wieder aktuelle Regelungen und Beispiele für gemeinnützige Vereine bespricht. Weitere Workshops und Informationen gibt es außerdem bei der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt, dem Haus des Stiftens, der Westfalen-Akademie und lokalen Anlaufstellen, wie z. B. der Geschäftsstelle Ehrenamt des Kreises Höxter.
Ansprechpersonen